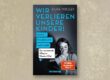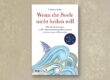Über Gesellschaft und Misogynie
Das Patriarchat der Dinge – Rebecca Endler &
Unsichtbare Frauen – Caroline Criado-Perez
Das Patriarchat der Dinge: DuMont Verlag, 2021, 336 Seiten Unsichtbare Frauen: btb Verlag, 2020, 496 Seiten
Die folgenden Punkte findet ihr in diesem Artikel:
Was haben öffentlicher Verkehr und Städteplanungen mit der Diskriminierung von Frauen zu tun?
Eine ganze Menge!
Immer noch gibt es Diskussionen darüber, ob Frauen denn heutzutage wirklich noch glauben können, benachteiligt zu werden.
Ist das nur eine individuelle Wahrnehmung?
„Das Patriarchat der Dinge“ und „Unsichtbare Frauen“ bringen Licht in das Erbe patriarchaler Strukturen unserer Gesellschaft und beleuchten die damit verbundene Ungleichheit der Geschlechter.
Die Autorinnen weiten mit ihren Büchern den Blick, sie zeigen auf, wie diese Strukturen, Narrative und unreflektierte Normen, unser aller Wertesystem, unseren Alltag beeinflussen und dass hier eine immense geschlechtsbezogene Datenlücke gibt, die dazu führt, dass wir noch weit entfernt davon sind, von Gleichberechtigung sprechen zu können.
Sozialisierung und Standards
Was wir gewöhnt sind, wie wir sozialisiert sind, das nehmen wir auch erstmal als selbstverständlich wahr, das wird als die Norm angesehen.
Dabei besteht die Gefahr, dass Diskriminierung nicht mehr bemerkt wird, weil es „so normal“ geworden ist.
Hinter der verzerrten Wahrnehmung fällt dann auch gar nicht mehr auf, dass das fehlende Wissen zu einer geschlechtsspezifischen Datenlücke führt, die einer systemischen Benachteiligung bestimmter Personengruppen Tür und Tor öffnet.
Was passiert, wenn wir einen Schritt zurücktreten und nochmal neu hinsehen, aus einer anderen Perspektive heraus, das zeigen die beiden Autorinnen in ihren Büchern.
„Das Bild vom Mann als Prototyp des Menschen ist grundlegend für die Struktur unserer Gesellschaft“ (S.17, Unsichtbare Frauen)
Es ist schon auffällig, dass sich viele Narrative, wie wir die Welt und Menschen wahrnehmen, um den (weiß-)männlich dominierten Blickwinkel mit ebensolchem Sprachausdruck drehen, so dass wir diesen ganz selbstverständlich auch als Norm annehmen.
Wie bereits in Frauenliteratur erwähnt, brauchen wir hier nur die Schulbücher aufschlagen, um zu erkennen, dass die Vermittlung von Wissen über die Geschichte eines Landes stets aus einer einseitigen Perspektive heraus geschieht.
(Wie ist das mit der Kolonialisierung? Was waren Aufgaben und Leistungen der Frauen während der Weltkriege? Usw.)
Patriarchale Macht- und Denkstrukturen sind in der Gesellschaft über alle Schichten tief verankert und haben eine lange Tradition.
In einer solchen Kultur werden männliche Erfahrungen als universell angesehen, das Weibliche als Abweichung.
Geschlechtsspezifische Datenlücke – einige Beispiele
Es ist wichtig dabei zu erkennen, dass die „Gender Data Gap“ „keine bösen Absichten verfolgt (…) Sie ist schlicht und einfach Ergebnis eines Denkens, das seit Jahrtausenden vorherrscht und deshalb eine Art Nicht-Denken ist. (…) Männer sind die unausgesprochene Selbstverständlichkeit, und über Frauen wird gar nicht geredet“ (S.11, Unsichtbare Frauen)
- Medikamentenstudien, Gesundheits-Tracking-Apps – doch der Monatszyklus, der durchaus aussagekräftig ist und Einfluss auf Medikamentenwirkung hat, wird vergessen.
- Anatomiebücher und Medizinische Daten, die für alle gelten – doch vergessen werden die geschlechtsspezifischen Unterschiede, von der Lage der Organe bis zum Verstoffwechseln, als auch bei Symptomatik und Risiken von Erkrankungen.
- Frauen werden in der Medizin weniger genau untersucht, ihre Symptome weniger ernst genommen und schneller als „psychisch“ eingestuft, so dass Frauen eine höhere Wahrscheinlichkeit von Fehldiagnosen und damit ein höheres Gesundheitsrisiko haben.
- Über den Ablauf von Geburten wird zunehmend von Männern verfügt: sie werden technisiert und medikalisiert. Mit Folgen für Mutter und Kind, Bindung und Entwicklung.
- Hygieneprodukte für die Menstruation fielen (bis vor Kurzem) mit der Mehrwertsteuer unter Luxusartikel, in Flüchtlingslagern zählen sie nicht zur Allgemeinversorgung.
- Sicherheitsuniformen für alle? Doch, vergessen wird, dass anatomische Unterschiede bestehen, die dazu führen, dass Kleidung eben für Frauen doch am Ende nicht mehr sicher ist.
- Fahrzeugsicherheit, medizinische Forschung und Studien, Sicherheit in der Bedienung von Maschinen, Nutzbarkeit von Technik, Werkzeugen und Sportgeräten, normiert wird am männlichen Standard, auch hier bleiben Frauen unsichtbar – und benachteiligt.
- Sexuelle Belästigung wird nach wie vor zu wenig untersucht oder verharmlost und damit wenig Einhalt geboten.
Patriarchaler Ausdruck in Narrativen und Sprache
Zahlreiche Studien, zeigen, dass besonders drei Themen immer wieder auftauchen:
- der weibliche Körper,
- unbezahlte Care-Arbeit sowie
- Gewalt von Männern an Frauen.
Sie sind von so großer Bedeutung, dass sie alle Bereiche – vom öffentlichen Verkehr, über Arbeitsplätze, ärztliche Eingriffe bis hin zur Politik betreffen.
Zahlreiche Untersuchungen haben auch gezeigt:
Wenn Männer sich erinnern, erinnern sie sich hauptsächlich an Männer.
Wenn Frauen unerwähnt bleiben, werden sie nicht automatisch mitgedacht.
Wir halten die meisten Dinge für männlich, solange sie nicht explizit als weiblich markiert sind.
Was allerdings männlich ist, muss nicht explizit erwähnt werden, weil es unausgesprochen bereits unterstellt oder angenommen wird.
Ob in Stellenausschreibungen, bei Berufsbezeichnungen, bei Kuscheltieren oder Computerspielfiguren, Zeichentrickfiguren, oder Spielzeugbezeichnungen wie „Gameboy“, usw.: wie oft nehmen wir die standardmäßige Darstellung vom Menschen (und anderen Wesen) als selbstverständlich männlich wahr!
Frauen verschwinden angesichts dieses Umstands in der Wahrnehmung, sie werden unsichtbar: im öffentlichen Raum, im Design, in der Literatur und Kunst allgemein, in finanzieller Hinsicht und im Berufsleben und im Alltagsleben, in der Medizin und in der Erinnerungskultur. Und letztendlich in der Sprache.
Es ist eine Tatsache: ob durch Straßennamen, auf Denkmälern, Geldscheinen, namhafte Künstler, Schriftsteller, Entdecker oder Preisverleihungen: es sind überwiegend (weiße) Männer, die gewürdigt werden.
Erfolge von Frauen werden oft geschmälert oder ausgeblendet – oder gar angeeignet.
Wer kennt nicht den Farady‘schen Käfig, die Gauss’sche Glocke, Einsteins Relativitätstheorie?
Doch warum reden wir eigentlich nicht von der Curie’schen Radioaktivität?
Erfahren wir, dass Nettie Stevens die Chromosomen als Ursache für das biologische Geschlecht entdeckte?
Oder Rosalind Franklin die DNA entdeckte?
Die letzten beiden Erfolge wurden sogar am Ende Männern zugeschrieben: der sog. Matthäus-Effekt.
Nicht selten in der Geschichte kam es vor, dass sich Männer die Errungenschaften und Werke von Frauen aneigneten, seien es musikalische Kompositionen oder wissenschaftliche Beiträge.
Übrigens: der erste funktionsfähige digitale Computer (im Jahr 1946) wurde übrigens von sechs Frauen programmiert! (S.150, Unsichtbare Frauen)
Wie die Arbeit und die Leistung von Frauen wahrgenommen, eingeschätzt und benannt werden, geschieht fast ausschließlich aus einer männlich dominierten Perspektive und Sprache heraus.
Der Eindruck von Gleichbehandlung unterliegt einer selektiven Wahrnehmung.
Denn dort, wo sie scheinbar herrscht, klaffen erst die riesigen Lücken auf.
Auf den zweiten Blick.
Ungleichheit
Der Gender Pay Gap wird in der Öffentlichkeit zwar schon diskutiert.
Doch mit der Gleichstellung in der Bezahlung hat es sich eben nicht allein.
Eine alleinstehende Frau, die gleichzeitig Mutter ist, mag vielleicht denselben hohen Posten erreicht haben wie ihre Kollegen und finanziell das Gleiche verdienen.
Doch erst am Ende zeigt sich, dass sie sowohl finanziell als auch sozial eben nicht gleichberechtigt ist.
Das zeigt das Beispiel aus „Unsichtbare Frauen“: eine alleinerziehende Mutter möchte an einem Kongresswochenende teilnehmen, dafür muss sie sich aber einen Babysitter leisten, sie wird Milch abpumpen (und dafür eine Maschine kaufen), und vielleicht am selben Abend noch auf eigene Faust 200 km zurück nach Hause fahren. Die Kollegen, die sich danach noch in eine Bar setzen und anschließend im Hotel übernachten werden, können Drinks und Hotelzimmer als Dienstausgaben absetzen, während Babysitter und Milchabpumpmaschine der Mutter als private Ausgaben gelten. Ganz zu schweigen von der Haushaltshilfe, die sie vielleicht einstellen muss, um überhaupt arbeiten gehen zu können.
Und letztendlich zieht sich diese Benachteiligung weiter und weiter, von der Einteilung in Steuerklassen, wo wiederum die (meist weniger verdienenden) Frauen benachteiligt werden bis hin zum Rentensystem.
Die Leistung von Frauen wird oftmals nicht gewürdigt und ja, manchmal nicht einmal wahrgenommen.
Frauen leisten unbezahlte Kinderbetreuung, Pflege-Arbeit, unterbezahlte Arbeit, werden als „billige“ Arbeitskräfte ausgenutzt.
Sie arbeiten mehr Stunden als Männer, denn oftmals bleiben Haushalt und Kinderversorgung an ihnen hängen.
Doch ob Care-Arbeiten, Haushalt und Mutterschaft, oder doch wissenschaftliche Beiträge – ihre Arbeiten und Errungenschaften werden weniger honoriert.
Männer schreiben Männern automatisch mehr geistige Brillianz zu, und bleiben weniger objektiv, insbesondere wenn es um die Mint-Fächer, Philosophie, Kunst/ Komposition/ Regie u.ä. geht. (Dieser Umstand konnte auch durch die Gegenprobe mit anonymisierten Auswahlverfahren bestätigt werden.)
In diesen Vorurteilen werden Kinder schon sehr früh, häufig aber mit Beginn der Schule sozialisiert, Spielzeug- und Fachinteressen werden gelenkt und bestimmte Eigenschaften, häufig nach Geschlecht unterschiedlich, zugeschrieben. (Mädchen eher „freundlich“, „fürsorglich“, „schön“, Jungen „ehrgeizig, selbstbewusst, erschaffend“)
Wie dadurch Selbstvertrauen, Selbstbild und Berufswahl von Mädchen und Jungen beeinflusst werden, wird stark unterschätzt. Sprache und Wahrnehmung sind Bereiche, in denen wir als Gesellschaft sensibler werden dürfen!
Die Wahrnehmung von Frauen in der Öffentlichkeit
„Powerfrau“ – ein Kompliment oder Diskriminierung?
Wenn Frauen besonders auffallen, wenn sie Job, Kinder, Partnerschaft, Freunde und vielleicht noch ein Ehrenamt parallel managen, dann werden sie gern als Powerfrau bezeichnet. Irgendwie impliziert das jedoch, dass weniger auffallende Frauen keine Powerfrauen sind. Dabei wird jedoch übersehen, dass diese Kür, diverse Aufgaben unter einen Hut zu bringen, von zahlreichen Frauen tagtäglich ganz selbstverständlich gemeistert wird, ohne dass es eine besondere Anerkennung gibt.
Der Unterschied wird noch deutlicher, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir solche Bezeichnungen bei Männern gar nicht brauchen…oder wie würde es in unseren Ohren klingen, wenn ein Mann ein “echter Powermann“ wäre, weil er mehrere Aufgaben parallel meistert? (s. „Das Patriarchat der Dinge“)
Im Gegenteil – was bei Frauen selbstverständlich und oftmals nicht der Rede (oder einer unangemessenen Rede) wert ist, wird bei Männern dann besonders hervorgehoben… „Wow, ein Mann, der sich neben seiner Arbeit auch um die Kinder kümmert…“
Das Bild von Frauen, die Wahrnehmung von Frauen, besonders in der Öffentlichkeit, unterliegt einem Narrativ, das verzerrt ist und das von patriarchalen Denk- und Machtstrukturen geprägt ist.
Ob als Dozentin an der Uni oder in der Politik:
Frauen, die empathischer und warmherziger auftreten, werden schnell als weniger kompetent und durchsetzungsfähig bewertet.
Frauen, die resoluter auftreten, die mit einer angemessenen Portion Wut ihre Meinung vertreten und sich für ihre Belange und Werte, gegen Diskriminierung oder für die Rechte von Frauen (oder anderer Personengruppen) progressiv und engagiert einsetzen, gelten hingegen als aggressiv, zickig oder hysterisch, während bei Männern sowohl die eine als auch die andere Eigenschaft sehr positiv begrüßt werden („Charme“, „Sympathieträger“) oder („durchsetzungsstark und kompetent“).
Der Redeanteil von Frauen in Diskussionsrunden wird stets geringer gehalten als der ihrer Kollegen und Männer unterbrechen Frauen häufiger als ihre Geschlechtsgenossen. Erlauben sich Frauen ein solches Verhalten, werden sie sofort abgestraft.
Frauenfeindliche Äußerungen gehören schon zum Alltag dazu.
Erfahrungen von Sexismus, Übergriffen und Gewalt sind allgegenwärtig für Frauen.
Sexuelle Belästigung ist so weit verbreitet, dass ca. 80-90 % Prozent der Frauen solche Erfahrungen gemacht haben.
Auf der Straße, am Arbeitsplatz, in den sozialen Medien usw.
Und die meisten davon werden nicht gemeldet – weil sie gar nicht ernst genommen werden.
Beleidigt werden aufgrund des Aussehens, Bodyshaming, Catcalling (s. unten, Podcastempfehlung) und anzügliche Bemerkungen, ungefragte Nacktbilder im Postfach, ungefragtes Anfassen, u.v.m.
Und leider gibt es keine Richtlinien, die diesem Umstand gesetzlich Einhalt gebieten würden, um dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen auch entsprechend nachzugehen.
Kaum eine Frau, die nicht ein beklemmendes Gefühl verspürt, wenn sie nach Anbruch der Dunkelheit alleine draußen unterwegs ist.
Die meisten planen ihre Wege entsprechend, soweit dies möglich ist, um sicherer zu sein oder sorgen für Begleitung, viele vermeiden es alleine nachts auf menschenleeren Straßen unterwegs zu sein.
Also Freie Bewegung für alle? Fehleinschätzung.
Frauen haben ein erhöhtes Risiko sexualisierte Gewalt zu erleben.
Besonders in Kriegen, aber auch nach Naturkatastrophen steigen die Fälle deutlich an. Fluchtgründe für Frauen sind oftmals Gewalterfahrungen und Unterdrückung, doch auf der Flucht sind sie erneut einem erheblichen Risiko ausgesetzt, sexuell ausgebeutet zu werden, an Grenzübergängen, Kontrollstationen, auf Polizeistationen, in Flüchtlingsheimen und -lagern.
Eine systematische Erfassung solcher Vergehen, Strafmaßnahmen oder Maßnahmen zur Prävention gibt es nicht wirklich.
Fazit
„Das Patriarchat der Dinge“ und „Unsichtbare Frauen“ zeigen auf eindrückliche und auch erschreckende Weise, dass die scheinbare Gleichberechtigung von Männern und Frauen noch nicht Realität ist.
Sie decken auf, wo nach wie vor Diskriminierung, oftmals im Verborgenen, stattfindet, weil Narrative und Haltungen als selbstverständlich angenommen und akzeptiert werden.
Sie beleuchten die Macht des männlichen Standards und wie die geschlechtsbezogene Datenlücke Frauen benachteiligt oder ihnen gar schadet und welche Folgen dies für ihr Leben hat – gesundheitlich, finanziell und sozial.
Rebecca Endler betrachtet in ihrem Buch „Das Patriarchat der Dinge“ das Thema von diverseren Standpunkten aus, (denn die Datenlücke und Benachteiligung betrifft ebenso BIPoC und queere Personen), behandelt aber für mein Empfinden eher einzelne ausgewählte Bereiche bzw. geht das Thema weniger in der Breite an, ist dafür aber kürzer und wesentlich leichter zu lesen, so dass es sich gut anbietet, um sich einen ersten Eindruck im Thema zu verschaffen.
Caroline Criado-Perez macht mit „Unsichtbare Frauen“ hingegen die ganze Bandbreite der Diskriminierung deutlich, indem sie umfassendere Analysen und brennende Themenbereiche ins Blickfeld rückt. Dafür war es mit unglaublich vielen Zahlen und Statistiken und Studien allerdings auch anstrengender zu lesen.
Doch egal, ob die eine oder die andere Lektüre, beide sind empfehlenswert, denn es geht um einen Weckruf, einen Ruf nach Veränderung, nach einem Perspektivwechsel, einen Ruf danach, dass Frauen endlich gesehen werden.
Augenöffnend – für alle!
Podcasttipp
„Der Tag eines Mannes hat 24 Stunden, der einer Frau nur so viele, wie es hell ist“ Antonia Quell
Ein sehr informatives Podcastinterview mit Antonia Quell zum Thema Catcalling findet ihr im Podcast einbiszwei, dem Podcast des UBSKM: https://beauftragter-